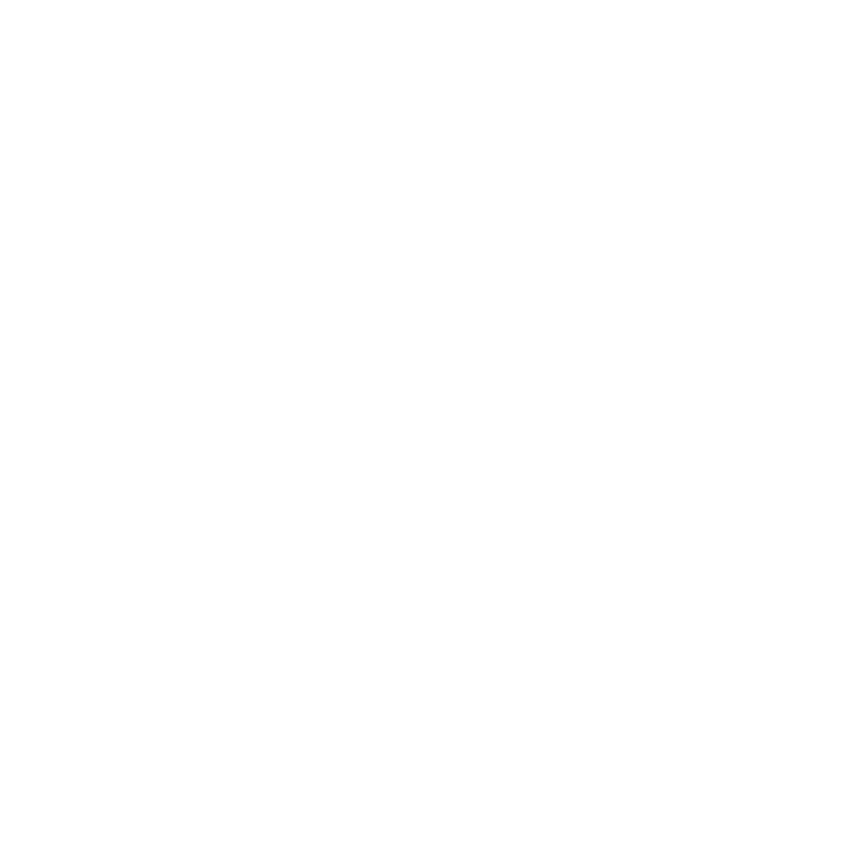Krisenintervention in Zeiten von Corona
„Die Schwere und Intensität der Einsätze nimmt zu!“ Marion Menzel, Bereichsleitung Prävention, Teilhabe und Krisenintervention in der Stiftung AKM, schildert im Interview, wie sich die Einsätze des Kriseninterventionsteams in den letzten Wochen verändert haben und mit welchen Sorgen die betreuten Familien derzeit zu kämpfen haben.
Marion, wie wirkt sich die Corona-Krise auf die Art und die Anzahl der Einsätze des Kriseninterventionsdienstes RUF24 aus?
„Ich sehe zweierlei: Durch die Ausgangsbeschränkungen sind Unfälle derzeit deutlich reduziert und damit haben wir insgesamt weniger Einsätze. Wo wir aber viel mehr Kontakt haben, das ist der Personenkreis der Hinterbliebenen, bei denen ein Familienmitglied verstorben ist. Denen fehlt der soziale Kontakt und damit der soziale Halt. Die Freunde sind nicht greifbar. Die Wohnung oder das Haus ist noch ein Stückchen leerer. Zudem können sie nicht einfach mal rausgehen und sich ablenken – im Kino, Theater oder Sportverein. Das alles ist nicht möglich. Das ist eine große Belastung, die wir in unseren RUF24-Einsätzen deutlich erkennen.
„Notfallmechanismen funktionieren nicht“
Auch der Personenkreis, bei dem eine psychische Grunderkrankung vorliegt, hat es derzeit schwer. Und wir haben Familien, bei denen ein Elternteil eine psychische Grunderkrankung hat und das Kind verstorben ist. Diese Kombination ist umso schwerer, da alle Stabilität und professionelle Maßnahmen reduziert sind oder sogar wegfallen. Auch alle erlernten Notfallmechanismen, die wir in der Krisenintervention anwenden, funktionieren nicht. Denn das, was den Menschen in dieser Krise guttun würde, können sie nicht machen. Wie zum Beispiel Freunde treffen, um aufgefangen zu werden. Vieles geht einfach nicht, und man kann sich gut vorstellen, wie bedrückend das ist.
„Intensität und Schwere der Einsätze nehmen zu“
Das heißt: Die Einsatzzahlen sind bei RUF24 in Zeiten von Corona nicht angestiegen. Aber was deutlich zunimmt, ist die Intensität und Schwere der Einsätze für uns Psychologen und Therapeuten. Denn: In der Krisenintervention ist es eine Maßnahme, nach der Stabilisierung Perspektiven zu schaffen und zu planen, wer in dem sozialen Netzwerk helfen und Gutes tun kann. Das alles ist unter Corona-Bedingungen viel schwieriger, weil soziale Netze, die sonst auffangen, stabilisieren und ablenken, derzeit nicht genutzt werden können. Deshalb gehen wir, wenn das gewünscht ist, auch weiterhin in die Familien. Wir sind aktuell einiger der wenigen Dienste, die auch als Therapeuten noch aufsuchend arbeiten. Und hier sehen wir, wie wichtig es gerade für hinterbliebene Elternteile ist, dass jemand nach wie vor nach Hause kommt. Sie nehmen auch in Kauf, dass wir volle Schutzkleidung tragen. Trotzdem ist ein Mensch da und man ist nicht allein. Wenn der Hinterbliebene schweigt, kann der Therapeut dennoch unterstützen. Diese nonverbalen Übertragungseffekte funktionieren nicht über Bildtelefonie. Schon unsere Präsenz gibt Stabilität. Das „Da-sein“ verändert etwas. Die Betroffenen nehmen unsere Hilfe derzeit mit sehr großer Dankbarkeit an. Wir haben teilweise Familien, in denen wir der einzige Kontakt sind.
„Unterstützende Rituale fallen weg“
Grundsätzlich gibt es bei RUF24 gerade eine Verlagerung, die es für uns sehr herausfordernd macht. Denn unterstützende Rituale fallen weg. Bei Familien, die wir neu kennenlernen, ist es sehr hilfreich, das zu Hause zu sehen und damit auch zum Beispiel den Kulturkreis zu erkennen. In der Krisenintervention muss ich jemand sehr schnell kennenlernen und viele Informationen sammeln, um ihn zu stützen. Und das ist aktuell extrem schwierig geworden, weil ich mich auf viele Dinge, die ich nur in der Bildtelefonie sehe, nicht verlassen kann. Ist das der reale Hintergrund? Trügt der Bildausschnitt? Ist jemand vielleicht viel unruhiger, als ich es in der Übertragung sehe?“
Wie wirken sich diese Beschränkungen speziell auf Familien mit schwerstkranken Kindern oder einem schwerkranken Elternteil aus?
„Vieles von dem, was derzeit in der breiten Öffentlichkeit diskutiert wird, betrifft viele der betroffenen Familien gar nicht. Denn diese Familien achten generell schon viel mehr auf Hygiene, als das „gesunde“ Familien tun. Sie kennen damit auch eine gewisse Form der Isolierung. Ich finde es aber schwierig, dass in der Kommunikation überwiegend von den alten Menschen als Risikogruppe gesprochen wird. Das ist nicht richtig. Familien mit schwersterkrankten Kindern und Elternteilen sind auch Risikogruppe und von der Gesellschaft schützenswert. Diese fehlende Anerkennung ist auch ein Belastungsfaktor.
„Familien sind auf sich alleine gestellt“
Ein weiterer ist, dass unterstützende Kräfte während der strengen Ausgangsbeschränkungen nicht mehr ins Haus gelassen werden konnten. Teilweise bricht auch die Versorgung durch ambulante Pflegedienste weg. Das heißt, die Familien sind auf sich gestellt. Und auf einmal haben wir die Situation, dass Kinder und Eltern mit Homeoffice und mit 24-Stunden-Pflege plötzlich auf sich allein gestellt sind. Und zunehmend diese Ängste aushalten müssen: Was passiert, wenn es mein Kind trifft? Was passiert, wenn ich zum Arzt oder in die Klinik muss? Wann können die Operationen stattfinden, auf die lange auch psychisch hingearbeitet worden ist und die dann verschoben werden mussten? Das sind viele Faktoren, die die ganze Situation noch anspruchsvoller machen“, so Marion Menzel.
Wie kann man diese Familien am besten unterstützen, Marion?
„Wir versuchen derzeit sehr viel präventiv zu arbeiten. Denn nicht jede Familie ist in einer akuten Krise, sondern es gibt ganz viele Ressourcen. Es ist uns deshalb ganz wichtig, dass die Beteiligten für sich Mechanismen erarbeiten, durch die sie im Fall einer Krise schneller reagieren können und nicht so tief fallen. Das heißt, idealerweise haben sie ihre Möglichkeiten an der Hand, die ihnen guttun und helfen.
Wir geben außerdem durch einen regelmäßigen „Ideenletter“ Anregung, wie man sich und die Kinder zu Hause am besten beschäftigen kann. Diese Ideenletter enthalten ganz viele Aspekte für die ganze Familie: Rezepte zum Backen, die glücklich machen (Glücksmuffins), Ideen zum Basteln und Spielen oder auch Entspannungsmöglichkeiten. Unsere Mitarbeiter haben zudem Gute-Nacht-Geschichten gelesen und aufgenommen, die auf der AKM-Website angehört werden können. Dann müssen die Eltern mal nicht selbst vorlesen, sondern haben in diesen Minuten Zeit für sich und können sich mal ausklinken. Einfach mal sechs Minuten die Füße hochlegen und durchatmen – das ist eine besondere Qualitätszeit. In diesem Moment steht dann mal nicht die Angst im Vordergrund.
„Wir sind an eurer Seite“
So gelingt es uns, trotz der Kontaktbeschränkungen weiterhin präventiv tätig zu sein und deutlich zu machen: Wir sind an Eurer Seite, auch wenn wir nicht da sind. Die Familien nehmen das sehr dankbar an. Am Anfang der Coronazeit haben wir diesen Ideenletter auch als Symbol gesehen und als Zeichen für die Familien: Wir sehen das Problem und wir helfen euch bei der Anpassung an diese neue Situation. Gerade in dieser Zeit haben wir ihn dreimal die Woche verschickt. Mittlerweile geht der Ideenletter nur noch einmal die Woche raus. Wir passen uns hier der aktuellen Situation immer an.“
Was können wir „Gesunde“ für uns in dieser Zeit Gutes tun?
„Zunächst einmal ist es wichtig anzuerkennen, dass das gerade eine verrückte Zeit ist. Wir alle haben für so eine Situation keinerlei Erfahrungswerte und damit auch keine Routine. Das ist für uns alle Arbeit, denn wir bewegen uns hier nicht auf gewohnten Pfaden. Deshalb ist es verständlich, dass wir erschöpfter und müder sind und mehr Erholungszeit brauchen.
„Nicht verdrängen, sondern annehmen“
Manche brauchen Distanz zum Alltag und den Blick von oben – da kann Spazieren gehen helfen, um zu spüren, was ich brauche. Wichtig ist: Nicht verdrängen, sondern annehmen, dass es eine Extremsituation ist. Wir haben alle weiterhin keine normalen Schulwege, keine normalen Arbeitswege, keine Routinen, ich muss über alles nachdenken. Es ist alles anders. Und das ist für uns alle Arbeit. Dementsprechend brauchen wir Erholungszeiten. Und da müssen wir uns einschätzen: Was bin ich für ein Mensch? Brauche ich eher Ruhe, Musik, Yoga, Pilates? Oder gehe ich lieber joggen, um den Kopf frei zu bekommen? Brauche ich das Gespräch mit jemand? Brauche ich Rituale, die ich trotzdem durchführen kann? Um durchzuatmen und mich zu erholen und daraus Kraft zu schöpfen.
Es geht schon so viele Wochen und es gibt immer noch keine Normalität. Das sind wir alle nicht gewohnt. Wir erleben mal singuläre Ereignisse und sehen die Auswirkungen. Zum Beispiel sehe ich nach einem Erdbeben die zerstörten Häuser. Aber jetzt fehlt die Visualisierung. Jetzt leben wir in einer unsicheren Zeit, obwohl draußen der Frühling sprießt und die Blumen blühen. Ich sehe keine Katastrophe. Das macht es so schwierig für uns“, beschreibt Marion Menzel.
Was ist das Problem am Mundnasenschutz – gerade auch für Kinder?
„Die Mundmimik ist wichtig für unsere Kommunikation und die fällt mit dem Mundnasenschutz weg. Die Orientierung am Mund ist etwas ganz Essentielles, das lernen wir schon im Säuglingsalter. Wir kennen es aus der Entwicklungspsychologie: Der Säugling schaut auf den Mund und geht dann weiter im ganzen Gesicht. Das fällt jetzt mit dem Mundnasenschutz für alle weg. Und das löst bei den Menschen Stress aus, auch bei Erwachsenen. Kindern macht das aber vor allem große Angst. Denn die Mundmimik bringt gerade Kindern, aber auch Erwachsenen in Stresszeiten normalerweise viel Orientierung.
„Mehr auf die Augen achten“
Mit der Maske ist wenig Ausdruck möglich, wenn ich nicht gerade besonders auf die Augenkommunikation achte. Das macht Kindern häufig Angst, da sie nicht einschätzen können, wie der andere im Gegenüber gesonnen ist. Eltern sollten den Kindern raten, mehr auf die Augen zu achten und mit ihnen auch üben, wie man besser auf den Ausdruck der Augen achten kann. Es ist wichtig, diese Ängste der Kinder ernst zu nehmen und darauf einzugehen.“